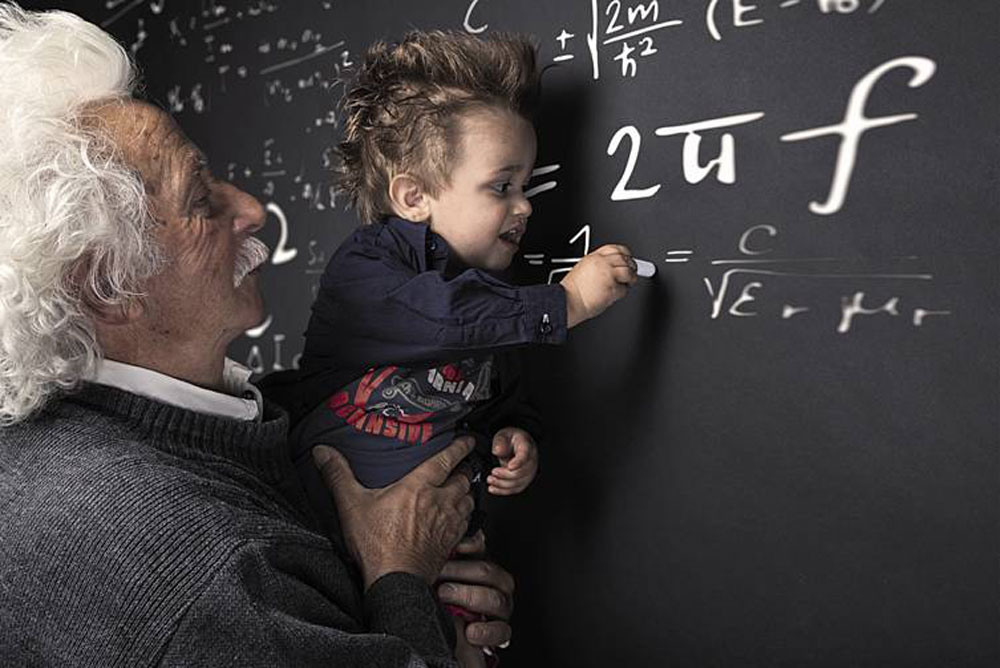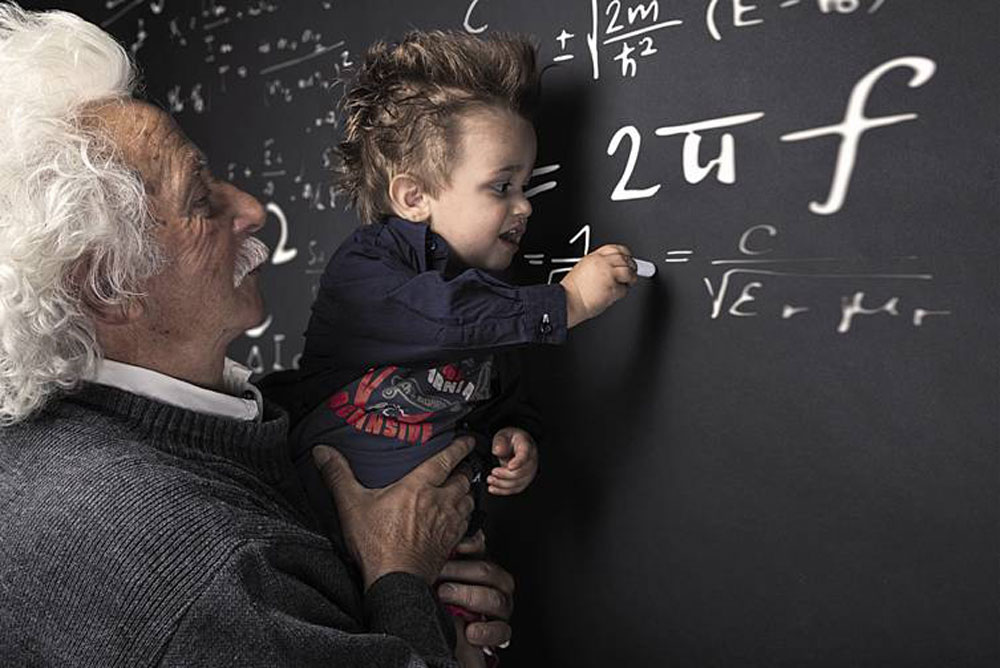Bologna ist nicht nur ein Wanda-Lied
Text
Gotthard Gansch
Ausgabe
11/2015
Als Abschluss der Serie Bildung wird ein Blick auf die Sekundarstufe II und den Tertiärbereich geworfen, also auf die Zeit nach gymnasialer Unterstufe oder Hauptschule bzw. NMS.
Im Tertiärbereich treffen (analog zu Diskussionen um die Gesamtschule) konträre politische Positionen aufeinander: Die Universitäten sind chronisch unterfinanziert und viele Studiengänge überlaufen. Fragen nach Studiengebühren oder Zugangsbeschränkungen werden von den Parteien unterschiedlich beantwortet. Das Konfliktpotential wird vor ÖH- und Nationalratswahlen regelmäßig sichtbar. Mittlerweile ist zumindest die Aufregung um die Abschaffung des eigenständigen Wissenschaftsministeriums verebbt.
Im Gegensatz dazu gibt die Sekundarstufe II wenig Anlass zur Kritik: Über eine Gesamtschule wird in diesem Bereich nicht diskutiert, vielmehr wird das bestehende Angebot durchaus positiv gesehen. Die Palette reicht von allgemeinbildenden bzw. berufsbildenden höheren (BHS) und berufsbildenden mittleren Schulen bis hin zu den Polytechnischen Schulen und Berufsschulen. Die Polytechnischen Schulen kämpfen aber mit Imageproblemen und schlechten Rahmenbedingungen. Das breite Spektrum an allgemeinbildenden und beruflichen Qualifikationswegen existiert nur in wenigen Ländern der OECD. Die berufsbildenden höheren Schulen bieten dabei etwa für Kinder aus sogenannten bildungsfernen Schichten eine Chance, höhere Bildung zu erreichen und erhöhen somit auch die Durchlässigkeit des österreichischen Schulsystems. Die steigende Affinität zu den BHS bei Eltern aus bildungsfernen Schichten (übrigens ein umstrittener Terminus) führt in weiterer Folge zu einem Anstieg des Bildungsniveaus: Seit 1960 hat sich die Anzahl bestandener Reife- und Diplomprüfungen vervierfacht, was aber vor allem auf die steigende Beliebtheit der BHS zurückzuführen ist. So hat sich die Zahl der Absolventen der BHS im selben Zeitraum sogar versiebenfacht. Der Trend zur „Verberufsschulung“ ist dabei auch global zu erkennen.
Im Gegensatz dazu gibt die Sekundarstufe II wenig Anlass zur Kritik: Über eine Gesamtschule wird in diesem Bereich nicht diskutiert, vielmehr wird das bestehende Angebot durchaus positiv gesehen. Die Palette reicht von allgemeinbildenden bzw. berufsbildenden höheren (BHS) und berufsbildenden mittleren Schulen bis hin zu den Polytechnischen Schulen und Berufsschulen. Die Polytechnischen Schulen kämpfen aber mit Imageproblemen und schlechten Rahmenbedingungen. Das breite Spektrum an allgemeinbildenden und beruflichen Qualifikationswegen existiert nur in wenigen Ländern der OECD. Die berufsbildenden höheren Schulen bieten dabei etwa für Kinder aus sogenannten bildungsfernen Schichten eine Chance, höhere Bildung zu erreichen und erhöhen somit auch die Durchlässigkeit des österreichischen Schulsystems. Die steigende Affinität zu den BHS bei Eltern aus bildungsfernen Schichten (übrigens ein umstrittener Terminus) führt in weiterer Folge zu einem Anstieg des Bildungsniveaus: Seit 1960 hat sich die Anzahl bestandener Reife- und Diplomprüfungen vervierfacht, was aber vor allem auf die steigende Beliebtheit der BHS zurückzuführen ist. So hat sich die Zahl der Absolventen der BHS im selben Zeitraum sogar versiebenfacht. Der Trend zur „Verberufsschulung“ ist dabei auch global zu erkennen.
Die Polytechnische Schule
Ein Sorgenkind der österreichischen Bildungslandschaft ist die Polytechnische Schule. Sie entstand als typisch österreichische Lösung: 1962 wurde die allgemeine Schulpflicht von acht auf neun Jahre verlängert. Die damalige große Koalition hatte unterschiedliche Ideen: Die Polytechnische Schule (damals Polytechnischer Lehrgang) stellt nun den Kompromiss zwischen der fünfjährigen Volksschule (ÖVP) und der fünfjährigen Mittelschule (SPÖ) dar, und ist dabei europaweit ein seltenes Konstrukt. Immer wieder gab es seither Reformversuche, die die Rahmenbedingungen und das schlechte Image verbessern sollten. So ist auch zur Zeit im Regierungsprogramm „eine Weiterentwicklung der Polytechnischen Schule (PTS) vorgesehen“, betont man im Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF). An aktuell 13 Standorten österreichweit gibt es einen entsprechenden Schulversuch, mit ersten Ergebnisse ist voraussichtlich kommendes Jahr zu rechnen. Bedenken, dass im Sog der Neuen Mittelschule die PTS in ihrer aktuellen Form überhaupt keinen Platz mehr im österreichischen Schulsystem haben könnte, werden zerstreut: „Die Polytechnische Schule ist als neunte Jahr der Schulpflicht derzeit nicht weg zu denken“, so das Ministerium.
Ein Sorgenkind der österreichischen Bildungslandschaft ist die Polytechnische Schule. Sie entstand als typisch österreichische Lösung: 1962 wurde die allgemeine Schulpflicht von acht auf neun Jahre verlängert. Die damalige große Koalition hatte unterschiedliche Ideen: Die Polytechnische Schule (damals Polytechnischer Lehrgang) stellt nun den Kompromiss zwischen der fünfjährigen Volksschule (ÖVP) und der fünfjährigen Mittelschule (SPÖ) dar, und ist dabei europaweit ein seltenes Konstrukt. Immer wieder gab es seither Reformversuche, die die Rahmenbedingungen und das schlechte Image verbessern sollten. So ist auch zur Zeit im Regierungsprogramm „eine Weiterentwicklung der Polytechnischen Schule (PTS) vorgesehen“, betont man im Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF). An aktuell 13 Standorten österreichweit gibt es einen entsprechenden Schulversuch, mit ersten Ergebnisse ist voraussichtlich kommendes Jahr zu rechnen. Bedenken, dass im Sog der Neuen Mittelschule die PTS in ihrer aktuellen Form überhaupt keinen Platz mehr im österreichischen Schulsystem haben könnte, werden zerstreut: „Die Polytechnische Schule ist als neunte Jahr der Schulpflicht derzeit nicht weg zu denken“, so das Ministerium.
Das Hochschulwesen – Bologna
Im tertiären Bildungsbereich wird der sogenannte Bologna-Prozess kritisiert. Die transnationale Hochschulreform, die im namensgebenden Bologna unterzeichnet wurde, setzt sich zum Ziel, einen gemeinsamen Hochschulraum zu schaffen. Damit einhergehend erfolgte die Umstellung auf das Bachelor-Master-System und die Einführung der ECTS-Punkte (European Credit Transfer System), mit der Studienleistungen institutions- und länderübergreifend verglichen und auch angerechnet werden sollen, um die Mobilität von Studenten zu fördern – so die Theorie. Ein abstraktes Schimpfen auf Bologna hält der Bildungswissenschaftler Stefan Hopmann (Universität Wien) jedoch für sinnlos, weil es ohnehin keine Alternative gab: „Das ist ja kein unausweichliches Schicksal, sondern eine politisch gewollte Entwicklung. Die Hochschulen hatten de facto keine Wahl: Bologna war für sie aus eigener Kraft nicht zu umgehen.“ Davon losgelöst kritisiert Hopmann die bisherige Entwicklung: „Der Bologna-Prozess ist der Versuch, politisch die Folgen der Massenexpansion der Hochschulbildung in Zeiten begrenzter öffentlicher Budgets zu verarbeiten. Kern der Strategie ist ähnlich wie in anderen sozialen Bereichen die Verlagerung der Verantwortung für die Folgen dieser Entwicklung an die Institutionen. Bei sinkenden Ausgaben pro Studierenden kann das zu nichts anderem führen als zu einem fortlaufenden Selbstverstümmelungsprozess der akademischen Institutionen.“ Die Intention des Bologna-Prozesses wurde verfehlt, wie Hopmann weiter ausführt: „Die symbolisch behaupteten Ziele einer Öffnung des europäischen Hochschulraums und einer übergreifenden Qualitätssicherung sind ganz sicher nicht erreicht worden, können mit diesen Mitteln auch kaum erzeugt werden. Stattdessen hat sich eine sich selbst vervielfältigende Bologna-Bürokratie auf allen Ebenen eingenistet. Was den Lehrenden und Studierenden unter diesen Bedingungen bleibt, ist der Versuch, aus dem sich perpetuierendem Elend so viel Tugend zu machen, wie grad jeweils noch geht.“ Der bekannte Philosoph Konrad Paul Liessmann (Universität Wien) sieht in Bologna gar die „Misere der europäischen Hochschulen“ und ein weiteres Moment im Prozess „der Verabschiedung der europäischen Universitätsidee.“ Vonseiten des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) ist die Einschätzung naturgemäß eine positivere: „Bologna hat mit der Einführung des Bachelor/Master Systems die Möglichkeit geschaffen, ein Bachelorstudium von 3-4 Jahren zu absolvieren, das auch bereits den Berufseinstieg ermöglicht. Diese neue Studienarchitektur bietet mehr Flexibilität und differenzierte Optionen, sofern sie in der Entwicklung der Studienpläne Berücksichtigung finden. Natürlich gibt es aber auch Kritikpunkte und Optimierungspotential, die im Rahmen des laufenden Umsetzungsprozesses thematisiert werden müssen und das geschieht sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene.“ In vielen Bereichen der Umsetzung des Bologna-Prozesses sei Österreich im europäischen Spitzenfeld zu finden. „Während in Österreich die Weiterentwicklung des Prozesses stetig forciert wurde, beteiligen sich einige Länder am Bologna-Prozess nicht mit dem erforderlichen Engagement“, so das Ministerium.
Im tertiären Bildungsbereich wird der sogenannte Bologna-Prozess kritisiert. Die transnationale Hochschulreform, die im namensgebenden Bologna unterzeichnet wurde, setzt sich zum Ziel, einen gemeinsamen Hochschulraum zu schaffen. Damit einhergehend erfolgte die Umstellung auf das Bachelor-Master-System und die Einführung der ECTS-Punkte (European Credit Transfer System), mit der Studienleistungen institutions- und länderübergreifend verglichen und auch angerechnet werden sollen, um die Mobilität von Studenten zu fördern – so die Theorie. Ein abstraktes Schimpfen auf Bologna hält der Bildungswissenschaftler Stefan Hopmann (Universität Wien) jedoch für sinnlos, weil es ohnehin keine Alternative gab: „Das ist ja kein unausweichliches Schicksal, sondern eine politisch gewollte Entwicklung. Die Hochschulen hatten de facto keine Wahl: Bologna war für sie aus eigener Kraft nicht zu umgehen.“ Davon losgelöst kritisiert Hopmann die bisherige Entwicklung: „Der Bologna-Prozess ist der Versuch, politisch die Folgen der Massenexpansion der Hochschulbildung in Zeiten begrenzter öffentlicher Budgets zu verarbeiten. Kern der Strategie ist ähnlich wie in anderen sozialen Bereichen die Verlagerung der Verantwortung für die Folgen dieser Entwicklung an die Institutionen. Bei sinkenden Ausgaben pro Studierenden kann das zu nichts anderem führen als zu einem fortlaufenden Selbstverstümmelungsprozess der akademischen Institutionen.“ Die Intention des Bologna-Prozesses wurde verfehlt, wie Hopmann weiter ausführt: „Die symbolisch behaupteten Ziele einer Öffnung des europäischen Hochschulraums und einer übergreifenden Qualitätssicherung sind ganz sicher nicht erreicht worden, können mit diesen Mitteln auch kaum erzeugt werden. Stattdessen hat sich eine sich selbst vervielfältigende Bologna-Bürokratie auf allen Ebenen eingenistet. Was den Lehrenden und Studierenden unter diesen Bedingungen bleibt, ist der Versuch, aus dem sich perpetuierendem Elend so viel Tugend zu machen, wie grad jeweils noch geht.“ Der bekannte Philosoph Konrad Paul Liessmann (Universität Wien) sieht in Bologna gar die „Misere der europäischen Hochschulen“ und ein weiteres Moment im Prozess „der Verabschiedung der europäischen Universitätsidee.“ Vonseiten des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) ist die Einschätzung naturgemäß eine positivere: „Bologna hat mit der Einführung des Bachelor/Master Systems die Möglichkeit geschaffen, ein Bachelorstudium von 3-4 Jahren zu absolvieren, das auch bereits den Berufseinstieg ermöglicht. Diese neue Studienarchitektur bietet mehr Flexibilität und differenzierte Optionen, sofern sie in der Entwicklung der Studienpläne Berücksichtigung finden. Natürlich gibt es aber auch Kritikpunkte und Optimierungspotential, die im Rahmen des laufenden Umsetzungsprozesses thematisiert werden müssen und das geschieht sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene.“ In vielen Bereichen der Umsetzung des Bologna-Prozesses sei Österreich im europäischen Spitzenfeld zu finden. „Während in Österreich die Weiterentwicklung des Prozesses stetig forciert wurde, beteiligen sich einige Länder am Bologna-Prozess nicht mit dem erforderlichen Engagement“, so das Ministerium.
Ein Gegen- und Miteinander
Liessmann befürchtet aber auch, dass durch Bologna die Trennung zwischen Fachhochschule und Universität aufgeweicht wird, wie er im Interview mit dem „Standard“ sagt: „Man hat Fachhochschulen gegründet, weil man eingesehen hat, dass es für eine Reihe gehobener Berufe eine akademische Ausbildung braucht, die aber nicht so wissenschafts- und forschungsorientiert sein soll oder muss wie die Universität. Nun macht der Bologna-Prozess die Universitäten selber partiell zu Fachhochschulen, weil das dreijährige Bachelor-Studium ja eine berufsqualifizierende und keine wissenschaftsorientierte Ausbildung ist.“ Der Unterschied zwischen Universität und FH werde in den Grundstudien belanglos sein: „Vieles, was sich Universität nennt, wird tatsächlich FH sein.“ Der Vorteil einer FH liege in ihrer Praxis- und Berufsorientierung und ihrer Flexibilität, so Liessmann in einem weiteren Interview mit „Die Presse“: „Universitäten sind demgegenüber nach wie vor durch die Dualität von Lehre und Forschung gekennzeichnet, sie sind per definitionem wissenschaftsorientiert, sie bilden nicht aus, sondern bieten eine wissenschaftliche Berufsvorbildung mit der Perspektive wissenschaftlicher Weiterqualifizierung an. Ich halte es deshalb auch für falsch, die FH zu forschungsorientierten Quasi-Universitäten hochzustilisieren, und die Universitäten […] zumindest in den Bachelor-Studiengängen zu FH herunterzuwirtschaften.“
Für die Leiterin des FH-Kollegiums in St. Pölten, Monika Vyslouzil, ist die Angst unberechtigt, ist Forschung schließlich ein wesentlicher Bestandteil einer FH: „Dass Fachhochschulen rasch erkannt haben, dass die Qualität der Lehre nur bei gleichzeitigen Forschungsaktivitäten auf einem aktuellen Stand gehalten werden kann, scheint sie in diesem Bereich in Konkurrenz zur Universität zu bringen.“ Der Fokus der Forschung überschneide sich dabei nur zum Teil: „So sind Mittel für Grundlagenforschung für Fachhochschulen kaum zugänglich, der Zugang zu Kooperationspartnern in der Praxis aufgrund der Ausrichtung der Studiengänge dafür leichter. Diese Differenzierung schreit buchstäblich nach einer Kooperation der Universitäten und Fachhochschulen in der Forschung – um Grundlagenforschung und Praxisorientierung fruchtbringend zu verbinden.“
Nach Meinung des Rektors der New Design University in St. Pölten, Stephan Schmidt-Wulffen, nivellieren sich allmählich die Unterschiede zwischen Fachhochschulen und Universitäten. „Ob Fachhochschulen deshalb aber schon das Promotionsrecht bekommen sollen, lasse ich dahingestellt.“ Vyslouzil hingegen findet es nicht „logisch nachvollziehbar“, weshalb man das Doktorat nur an der Universität machen könne, da manche Studienrichtungen die Universität gar nicht anbiete. „Nach meinem Verständnis einer Doktorarbeit soll darin eine wissenschaftliche Weiterentwicklung erfolgen, natürlich theoretisch fundiert, aber Lehre und Forschung an Fachhochschulen erfolgt nicht im luftleeren Raum und ist sehr wohl wissenschaftlich fundiert“, so Vyslouzil. Weder die eine noch die andere Einrichtung sei jedoch besser oder schlechter: „Sie sind verschieden, und das mit Grund, und sollten einander wunderbar ergänzen.“
Ökonomisierung des Hochschulsektors?
Dem Hochschulsektor fehlt es an Geld, er ist von staatlicher Seite chronisch unterfinanziert. Der Trend an den Universitäten gehe nun eindeutig in Richtung Ökonomisierung, befindet Liessmann: „Es könnte sein, dass die Universität der Zukunft in der selben Abhängigkeit von der Wirtschaft sein wird wie die Universität des Mittelalters von der Kirche.“ Ökonomisierung betreffe jedoch die gesamte Kultur, und somit natürlich auch die Universitäten, ergänzt Schmidt-Wulffen. Es müsse zwischen ökonomischen Zwängen und einem Dialog mit der Wirtschaft unterschieden werden: „Ein Dialog mit der Wirtschaft ist für eine Universität sinnvoll, die gesellschaftlich relevante Forschung betreiben will und sich mit zeitgenössischen Fragen auseinandersetzen muss.“ Ein Umdenken müsse stattfinden, ein komplexeres Verständnis von Erfolg entwickelt werden, nicht kurzfristige Kosten-Nutzen-Rechnungen: „Es lässt sich belegen, dass die meisten Innovationen, die langfristig wirtschaftlichen Erfolg gebracht haben, nicht in einem kurzfristigen ökonomischen Kalkül entstanden wären.“
Der offene Hochschulzugang
Die unter Kanzler Schüssel wiedereingeführten Studiengebühren wurden in Österreich nicht abgeschafft, an Universitäten gibt es aber derzeit viele Ausnahmeregelungen, sodass de facto nur wenige davon betroffen sind. Fachhochschulen können hingegen autonom entscheiden, ob Studiengebühren eingehoben werden sollen. Fast alle Fachhochschulen heben diese in der Höhe von 363,36 Euro pro Semester ein (hinzu kommt noch der verpflichtende ÖH-Beitrag, dieser ist von jedem Studierenden zu bezahlen). Auch an der FH St. Pölten sind diese Gebühren zu verrichten. Privatuniversitäten wie etwa die New Design University in St. Pölten haben weitaus höhere Studiengebühren (ab 2.900 Euro pro Semester), wobei sich die Unterfinanzierung der österreichischen Hochschullandschaft paradoxerweise als Chance für die Privatuniversitäten darstellt, weil man Studierenden „eine persönliche und individuelle Betreuung auf höchstem Niveau“ bieten kann, so Schmidt-Wulffen. Eine Regelung wie unter Kanzler Schüssel wird es nicht geben, wie man vonseiten des Ministeriums erklärt: „Derzeit ist eine Wiedereinführung der Studiengebühren nicht angedacht, da diese nicht Agenda des Regierungsprogramms sind.“
Der viel zitierte offene Hochschulzugang bringt aber auch Schwierigkeiten mit sich, wie Hopmann ausführt: „Das Problem ist die Expansion des Hochschulsektors bei begrenzten öffentlichen Mitteln. Wenn das – wie in Österreich – in Teilbereichen ungebremst geschieht, führt das in den Bereichen, in denen freier Zugang für alle herrscht, unweigerlich zu einem chronischen, manchmal wie in meinem Fach oder wie in Teilen der universitären Lehrerbildung zu einem extremen Missverhältnis von Ressourcen und Studierendenzahlen. Die Frage ist, wie man damit umgehen will, wenn man nicht willens oder in der Lage ist, die Hochschulfinanzierung der gestiegenen Nachfrage anzupassen.“ Man könne nun „gar nicht“, durch Studiengebühren oder durch Zugangsbeschränkungen darauf reagieren. Alle Verfahren hätten dabei Auswirkungen auf Studienqualität und Chancengleichheit. „Verfahren 1 drängt alle, die im Wettrennen zu den begrenzten Studienplätzen nicht mithalten können oder wollen, in überfüllte Fächer mit hohen Durchfallquoten, vor allem zulasten jener, denen das soziale und/oder ökonomische Kapital fehlt, das akademische Elend zu umschiffen. Zudem führt es dazu, dass die österreichischen Hochschulen international immer weniger konkurrenzfähig sind.“ Studiengebühren hätten nur dann regulierende Wirkung, wenn sie so substantiell sind, dass mit ihnen verbesserte Studienbedingungen ermöglicht werden können und zugleich sozial und fachspezifisch aufgefangen werden, da dies ansonsten zu ähnlichen Effekten wie in Verfahren 1 führe. Zugangsbeschränkungen seien ebenso nicht unproblematisch, da es „keine Verfahren gibt, die (a) tatsächlich die Auswahl der Bestgeeigneten garantieren können und (b) gegen allfällige soziale, ökonomische usw. Ungleichgewichte immun sind, läuft es im Ergebnis auch hier darauf hinaus, den Mangel sozial von oben nach unten umzuverteilen.“ Wie der Bologna-Prozess sei es aber vor allem eine politische, keine wissenschaftliche Fragestellung: „Will man den freien Hochschulzugang für alle, wird man den irgendwie ausfinanzieren müssen, sonst verschiebt man zulasten der Studienqualität die soziale Selektion an die Universität. Will man keinen freien Hochschulzugang, wird man Verfahren finden müssen, die die sozialen Nebenwirkungen begrenzen.“ Wird aber nichts getan, sorge man nur für miserable und unfaire Studienbedingungen. „Das Letztere ist das, was in den letzten Jahren entgegen allen Beteuerungen billigend in Kauf genommen worden ist“, so Hopmann abschließend.
BILDUNGSSTADT ST. PÖLTEN
Studentenzahlen in St. Pölten (2013)
FH St. Pölten 1.902
Philosophisch Theologische Hochschule der Diözese St. Pölten 82
New Design University 322
Collegs 133
Gesamt: 2.439
Liessmann befürchtet aber auch, dass durch Bologna die Trennung zwischen Fachhochschule und Universität aufgeweicht wird, wie er im Interview mit dem „Standard“ sagt: „Man hat Fachhochschulen gegründet, weil man eingesehen hat, dass es für eine Reihe gehobener Berufe eine akademische Ausbildung braucht, die aber nicht so wissenschafts- und forschungsorientiert sein soll oder muss wie die Universität. Nun macht der Bologna-Prozess die Universitäten selber partiell zu Fachhochschulen, weil das dreijährige Bachelor-Studium ja eine berufsqualifizierende und keine wissenschaftsorientierte Ausbildung ist.“ Der Unterschied zwischen Universität und FH werde in den Grundstudien belanglos sein: „Vieles, was sich Universität nennt, wird tatsächlich FH sein.“ Der Vorteil einer FH liege in ihrer Praxis- und Berufsorientierung und ihrer Flexibilität, so Liessmann in einem weiteren Interview mit „Die Presse“: „Universitäten sind demgegenüber nach wie vor durch die Dualität von Lehre und Forschung gekennzeichnet, sie sind per definitionem wissenschaftsorientiert, sie bilden nicht aus, sondern bieten eine wissenschaftliche Berufsvorbildung mit der Perspektive wissenschaftlicher Weiterqualifizierung an. Ich halte es deshalb auch für falsch, die FH zu forschungsorientierten Quasi-Universitäten hochzustilisieren, und die Universitäten […] zumindest in den Bachelor-Studiengängen zu FH herunterzuwirtschaften.“
Für die Leiterin des FH-Kollegiums in St. Pölten, Monika Vyslouzil, ist die Angst unberechtigt, ist Forschung schließlich ein wesentlicher Bestandteil einer FH: „Dass Fachhochschulen rasch erkannt haben, dass die Qualität der Lehre nur bei gleichzeitigen Forschungsaktivitäten auf einem aktuellen Stand gehalten werden kann, scheint sie in diesem Bereich in Konkurrenz zur Universität zu bringen.“ Der Fokus der Forschung überschneide sich dabei nur zum Teil: „So sind Mittel für Grundlagenforschung für Fachhochschulen kaum zugänglich, der Zugang zu Kooperationspartnern in der Praxis aufgrund der Ausrichtung der Studiengänge dafür leichter. Diese Differenzierung schreit buchstäblich nach einer Kooperation der Universitäten und Fachhochschulen in der Forschung – um Grundlagenforschung und Praxisorientierung fruchtbringend zu verbinden.“
Nach Meinung des Rektors der New Design University in St. Pölten, Stephan Schmidt-Wulffen, nivellieren sich allmählich die Unterschiede zwischen Fachhochschulen und Universitäten. „Ob Fachhochschulen deshalb aber schon das Promotionsrecht bekommen sollen, lasse ich dahingestellt.“ Vyslouzil hingegen findet es nicht „logisch nachvollziehbar“, weshalb man das Doktorat nur an der Universität machen könne, da manche Studienrichtungen die Universität gar nicht anbiete. „Nach meinem Verständnis einer Doktorarbeit soll darin eine wissenschaftliche Weiterentwicklung erfolgen, natürlich theoretisch fundiert, aber Lehre und Forschung an Fachhochschulen erfolgt nicht im luftleeren Raum und ist sehr wohl wissenschaftlich fundiert“, so Vyslouzil. Weder die eine noch die andere Einrichtung sei jedoch besser oder schlechter: „Sie sind verschieden, und das mit Grund, und sollten einander wunderbar ergänzen.“
Ökonomisierung des Hochschulsektors?
Dem Hochschulsektor fehlt es an Geld, er ist von staatlicher Seite chronisch unterfinanziert. Der Trend an den Universitäten gehe nun eindeutig in Richtung Ökonomisierung, befindet Liessmann: „Es könnte sein, dass die Universität der Zukunft in der selben Abhängigkeit von der Wirtschaft sein wird wie die Universität des Mittelalters von der Kirche.“ Ökonomisierung betreffe jedoch die gesamte Kultur, und somit natürlich auch die Universitäten, ergänzt Schmidt-Wulffen. Es müsse zwischen ökonomischen Zwängen und einem Dialog mit der Wirtschaft unterschieden werden: „Ein Dialog mit der Wirtschaft ist für eine Universität sinnvoll, die gesellschaftlich relevante Forschung betreiben will und sich mit zeitgenössischen Fragen auseinandersetzen muss.“ Ein Umdenken müsse stattfinden, ein komplexeres Verständnis von Erfolg entwickelt werden, nicht kurzfristige Kosten-Nutzen-Rechnungen: „Es lässt sich belegen, dass die meisten Innovationen, die langfristig wirtschaftlichen Erfolg gebracht haben, nicht in einem kurzfristigen ökonomischen Kalkül entstanden wären.“
Der offene Hochschulzugang
Die unter Kanzler Schüssel wiedereingeführten Studiengebühren wurden in Österreich nicht abgeschafft, an Universitäten gibt es aber derzeit viele Ausnahmeregelungen, sodass de facto nur wenige davon betroffen sind. Fachhochschulen können hingegen autonom entscheiden, ob Studiengebühren eingehoben werden sollen. Fast alle Fachhochschulen heben diese in der Höhe von 363,36 Euro pro Semester ein (hinzu kommt noch der verpflichtende ÖH-Beitrag, dieser ist von jedem Studierenden zu bezahlen). Auch an der FH St. Pölten sind diese Gebühren zu verrichten. Privatuniversitäten wie etwa die New Design University in St. Pölten haben weitaus höhere Studiengebühren (ab 2.900 Euro pro Semester), wobei sich die Unterfinanzierung der österreichischen Hochschullandschaft paradoxerweise als Chance für die Privatuniversitäten darstellt, weil man Studierenden „eine persönliche und individuelle Betreuung auf höchstem Niveau“ bieten kann, so Schmidt-Wulffen. Eine Regelung wie unter Kanzler Schüssel wird es nicht geben, wie man vonseiten des Ministeriums erklärt: „Derzeit ist eine Wiedereinführung der Studiengebühren nicht angedacht, da diese nicht Agenda des Regierungsprogramms sind.“
Der viel zitierte offene Hochschulzugang bringt aber auch Schwierigkeiten mit sich, wie Hopmann ausführt: „Das Problem ist die Expansion des Hochschulsektors bei begrenzten öffentlichen Mitteln. Wenn das – wie in Österreich – in Teilbereichen ungebremst geschieht, führt das in den Bereichen, in denen freier Zugang für alle herrscht, unweigerlich zu einem chronischen, manchmal wie in meinem Fach oder wie in Teilen der universitären Lehrerbildung zu einem extremen Missverhältnis von Ressourcen und Studierendenzahlen. Die Frage ist, wie man damit umgehen will, wenn man nicht willens oder in der Lage ist, die Hochschulfinanzierung der gestiegenen Nachfrage anzupassen.“ Man könne nun „gar nicht“, durch Studiengebühren oder durch Zugangsbeschränkungen darauf reagieren. Alle Verfahren hätten dabei Auswirkungen auf Studienqualität und Chancengleichheit. „Verfahren 1 drängt alle, die im Wettrennen zu den begrenzten Studienplätzen nicht mithalten können oder wollen, in überfüllte Fächer mit hohen Durchfallquoten, vor allem zulasten jener, denen das soziale und/oder ökonomische Kapital fehlt, das akademische Elend zu umschiffen. Zudem führt es dazu, dass die österreichischen Hochschulen international immer weniger konkurrenzfähig sind.“ Studiengebühren hätten nur dann regulierende Wirkung, wenn sie so substantiell sind, dass mit ihnen verbesserte Studienbedingungen ermöglicht werden können und zugleich sozial und fachspezifisch aufgefangen werden, da dies ansonsten zu ähnlichen Effekten wie in Verfahren 1 führe. Zugangsbeschränkungen seien ebenso nicht unproblematisch, da es „keine Verfahren gibt, die (a) tatsächlich die Auswahl der Bestgeeigneten garantieren können und (b) gegen allfällige soziale, ökonomische usw. Ungleichgewichte immun sind, läuft es im Ergebnis auch hier darauf hinaus, den Mangel sozial von oben nach unten umzuverteilen.“ Wie der Bologna-Prozess sei es aber vor allem eine politische, keine wissenschaftliche Fragestellung: „Will man den freien Hochschulzugang für alle, wird man den irgendwie ausfinanzieren müssen, sonst verschiebt man zulasten der Studienqualität die soziale Selektion an die Universität. Will man keinen freien Hochschulzugang, wird man Verfahren finden müssen, die die sozialen Nebenwirkungen begrenzen.“ Wird aber nichts getan, sorge man nur für miserable und unfaire Studienbedingungen. „Das Letztere ist das, was in den letzten Jahren entgegen allen Beteuerungen billigend in Kauf genommen worden ist“, so Hopmann abschließend.
BILDUNGSSTADT ST. PÖLTEN
Studentenzahlen in St. Pölten (2013)
FH St. Pölten 1.902
Philosophisch Theologische Hochschule der Diözese St. Pölten 82
New Design University 322
Collegs 133
Gesamt: 2.439
Schülerzahlen der höheren Schulen in St. Pölten (inkl. allfälliger Unterstufe, 2013)
BRG u. BORG 867
BG u. BRG 906
Mary Ward Privatg. u. ORG 492
BHAK 702
BBAKIP 331
BBASOP 276
Höhere Lehranstalt für Tourismus im WIFI 240
HTBLuVA 1.269
Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe 514
Gesamt: 5.597
Quelle: Magistrat St. Pölten
BRG u. BORG 867
BG u. BRG 906
Mary Ward Privatg. u. ORG 492
BHAK 702
BBAKIP 331
BBASOP 276
Höhere Lehranstalt für Tourismus im WIFI 240
HTBLuVA 1.269
Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe 514
Gesamt: 5.597
Quelle: Magistrat St. Pölten